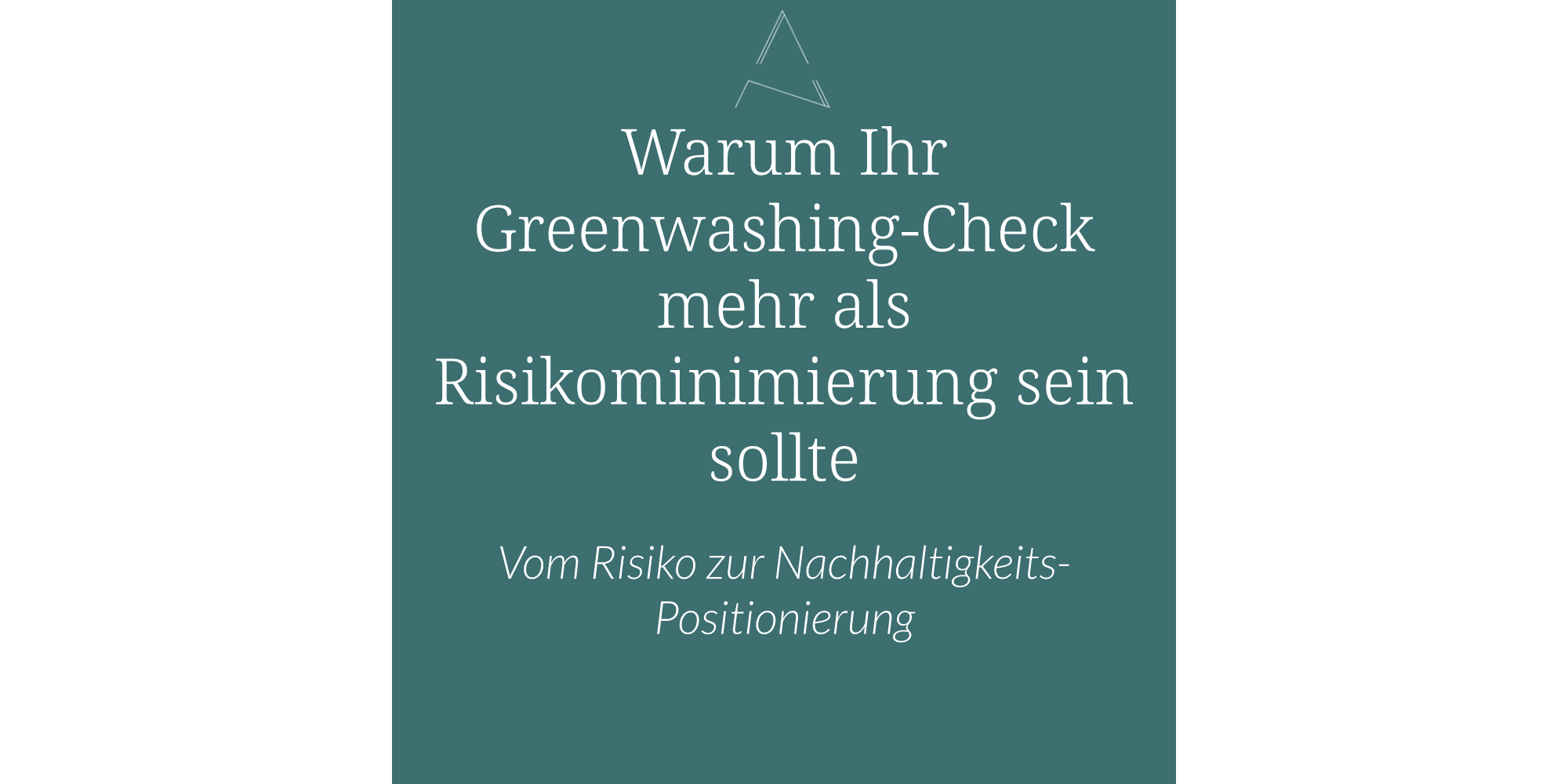
Warum Ihr Greenwashing-Check mehr als Risikominimierung sein sollte
Ein Werkzeugmaschinenhersteller aus Baden-Württemberg bewirbt seine neueste Baureihe als „umweltschonend“. Ein Automobilzulieferer kommuniziert „nachhaltige Produktion“. Ein Handelsbetrieb wirbt mit „grüner Logistik“. Könnte hier schon Greenwashing im Spiel sein?
Das sind drei Beispiele aus dem unternehmerischen Alltag. Drei Botschaften, die auf den ersten Blick durchaus berechtigt erscheinen. Und drei potenzielle Fallstricke für die EU-Richtlinie 2024/825, die ab September 2026 die Spielregeln für Umweltaussagen fundamental verändern wird.
In diesem Blogpost ordnen wir die Vorgaben nach der EU Greenwashing Richtlinie ein und stellen unser Greenwashing-Check-Tool vor, mit dem Sie einen ersten Überblick erhalten.
Die neuen Vorgaben nach der EU-Richtlinie
Die EU-Richtlinie 2024/825 gegen Greenwashing bedeutet eine Zeitenwende für die Nachhaltigkeitskommunikation im Mittelstand. Was bisher als marketingtaugliche Begriffe wie „umweltfreundlich“, „nachhaltig“ oder „klimaneutral“ durchging, bedarf künftig detaillierter wissenschaftlicher Substantiierung und unabhängiger Verifizierung.
Die regulatorischen Eckpunkte sind eindeutig. Es kann Bußgelder von mindestens 4% des Jahresumsatzes geben, verstärkte Kontrollen durch Verbraucherschutzverbände und ein deutlich erhöhtes Reputationsrisiko bei unzureichend belegten Umweltaussagen. Besonders betroffen sind allgemeine Begriffe wie „klimaneutral“, „umweltfreundlich“ oder „grün“, die künftig nur noch mit nachweisbarer Umweltleistung verwendet werden dürfen. Auch Nachhaltigkeitssiegel ohne zertifizierte Prüfverfahren sind ab September 2026 unzulässig.
Parallel zu den verschärften Anforderungen entstehen unserer Ansicht nach strategische Chancen, die Mittelständler bereits heute nutzen können.
Die zentrale Frage für den Mittelstand
Angesichts dieser verschärften Anforderungen stellt sich für mittelständische Unternehmen eine entscheidende Frage: Wie können Sie Ihre Nachhaltigkeitskommunikation bis September 2026 nicht nur rechtssicher gestalten, sondern gleichzeitig für strategische Wettbewerbsvorteile nutzen?
Die Antwort liegt in einem systematischen Ansatz, der regulatorische Compliance und strategische Positionierung verbindet.
Vom Greenwashing-Risiko zur strategischen Chance
Strukturiertes Vorgehen zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2024/825 – in vier strategischen Schritten bis September 2026
Bestandsaufnahme
- Umweltaussagen dokumentieren
- Belegbarkeit prüfen
- Ungenutzte Stärken identifizieren
Analyse der bestehenden Lücken
- Lücken identifizieren
- Risiken bewerten
- Nach Aufwand und Impact priorisieren
Strategische Positionierung
- Regulatorische Sicherheit schaffen
- Marktchancen nutzen
- Authentische Differenzierung erreichen
Operative Umsetzung
- Mess- und Dokumentationssysteme aufbauen
- Mitarbeiter schulen
- Kontinuierliche Verbesserung etablieren
Sie möchten Ihre Nachhaltigkeitskommunikation strategisch durchdenken? Unser Greenwashing-Check Tool bietet einen systematischen Einstieg in die Analyse Ihrer aktuellen Positionierung.
Zum Greenwashing-Check ToolVom Greenwashing-Risiko zur Positionierung
Wir sind davon überzeugt, dass Unternehmen, die Nachhaltigkeit strategisch durchdenken statt rein regulatorisch abhandeln, zukünftige Wettbewerbsvorteile für sich entwickeln können.
Die EU-Richtlinie verbietet allgemeine Umweltaussagen wie „umweltfreundlich“, „grün“ oder „klimaneutral“, es sei denn, Unternehmen können eine „anerkannte hervorragende Umweltleistung“ nachweisen. Diese Anforderung mag zunächst restriktiv und abstrakt erscheinen, schafft aber gleichzeitig Klarheit: Wer seine Nachhaltigkeitsleistungen fundiert belegen kann, erhält einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber oberflächlicher Kommunikation.
Die entscheidende Erkenntnis: Regulatorische Compliance und strategische Positionierung schließen sich nicht aus – im Gegenteil. Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeitsleistungen wissenschaftlich fundiert belegen können, verfügen über authentische Differenzierungsmerkmale im Markt.
Wer seine Nachhaltigkeitsleistungen fundiert belegen kann, erhält einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber oberflächlicher Kommunikation.
Systematische Bestandsaufnahme: Was Sie heute wissen müssen
Die Vorbereitung auf die EU-Richtlinie erfordert eine ehrliche Bestandsaufnahme der eigenen Nachhaltigkeitskommunikation.
Folgende Kernfragen stehen unter anderem im Mittelpunkt:
- Können Sie jede Umweltaussage mit wissenschaftlich anerkannten Daten belegen? Verfügen Sie über Mess- und Bewertungsmethoden, die einer kritischen Prüfung standhalten?
- Sind Ihre Nachhaltigkeitsaussagen durch unabhängige Dritte validiert? Welche Zertifizierungen und Audits liegen vor, welche fehlen noch?
- Auf welcher Basis erfolgen Vergleiche mit Wettbewerbern oder Vorgängerprodukten? Sind die Referenzwerte transparent und nachvollziehbar?
- Berücksichtigen Sie den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte oder fokussieren Sie nur auf ausgewählte Aspekte?
- Entsprechen Ihre Daten dem neuesten Stand der Technik? Wie stellen Sie sicher, dass veraltete Informationen nicht weiter kommuniziert werden?
Diese Fragen mögen auf den ersten Blick komplex erscheinen. Doch sie bieten die Grundlage für eine belastbare Nachhaltigkeitsstrategie, die sowohl regulatorischen Anforderungen genügt als auch geschäftliche Mehrwerte schafft.
Parallel zu den verschärften Anforderungen entstehen unserer Ansicht nach strategische Chancen, die Mittelständler bereits heute nutzen können.
Nachhaltige Wettbewerbsvorteile entwickeln
Im systematischen Aufbau authentischer Nachhaltigkeitskompetenz liegt eine starke strategische Chance. Unternehmen, die diese Chance ergreifen, positionieren sich in einem Marktumfeld, in dem oberflächliche „Green Claims“ zunehmend durchschaut werden.
Ein strukturierter Ansatz zur Analyse der eigenen Position schafft Klarheit über Stärken und Handlungsbedarfe.
Dabei geht es nicht um perfektionistische Vollständigkeit, sondern um strategische Prioritätensetzung:
- Welche Nachhaltigkeitsaspekte sind für Ihr Geschäftsmodell wirklich relevant?
- Wo können Sie authentische Vorteile entwickeln?
- Welche Risiken sollten Sie prioritär adressieren?
Der Faktor Zeit oder: Warum frühe Vorbereitung strategische Vorteile schafft
September 2026 mag noch fern erscheinen, doch die Zeit bis zur Umsetzung der verschärften Regeln können Unternehmen aktiv nutzen.
Die Entwicklung belastbarer Mess- und Dokumentationssysteme, die Durchführung unabhängiger Verifizierungen und die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Unternehmensstrategie erfordern systematische Vorbereitung.
Ein strukturiertes Vorgehen zur Umsetzung der Richtlinie
Für die konkrete Umsetzung empfiehlt sich ein stufenweises Vorgehen:
- Bestandsaufnahme: Systematische Erfassung aller aktuellen Umweltaussagen und deren Dokumentationsstand. Hierbei zeigt sich oft, dass viele Unternehmen besser positioniert sind als angenommen, dies aber unzureichend kommunizieren.
- Analyse der bestehenden Lücken: Abgleich zwischen Ist-Zustand und regulatorischen Anforderungen. Priorisierung nach Aufwand und strategischem Impact.
- Strategische Positionierung: Entwicklung einer kohärenten Nachhaltigkeitserzählung, die regulatorische Sicherheit mit Marktchancen verbindet.
- Operative Umsetzung: Implementierung notwendiger Prozesse, Schulung relevanter Mitarbeiter, Etablierung kontinuierlicher Verbesserungszyklen.
Chance zur strategischen Positionierung nutzen
Die EU-Richtlinie 2024/825 ist mehr als eine regulatorische Hürde – sie ist eine Chance zur strategischen Neupositionierung. Unternehmen, die Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil ihrer Wertschöpfung begreifen und professionell kommunizieren, werden sich deutlich von jenen abheben, die Umweltaussagen als Marketingbeiwerk behandeln.
Sie möchten Ihre Nachhaltigkeitskommunikation strategisch durchdenken?
Das Greenwashing-Check Tool bietet einen systematischen Einstieg in die Analyse Ihrer aktuellen Positionierung. Hier erfahren Sie mehr.
Gerne diskutieren wir mit Ihnen die spezifischen Implikationen für Ihr Unternehmen und entwickeln gemeinsam einen strategischen Umsetzungsansatz.
Vereinbaren Sie hier Ihr Kennenlerngespräch mit NordKompass.
Häufige Fragen zu Greenwashing
Hier beantworten wir Ihnen Fragen zum Blogartikel.
Weitere Antworten finden Sie auf unserer Homepage unter Fragen und Antworten.
Gilt die EU-Richtlinie auch für kleine und mittelständische Unternehmen?
Ja, die EU-Richtlinie 2024/825 gilt für alle Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen auf dem EU-Markt anbieten – unabhängig von Größe oder Branche. Entscheidend ist nicht die Unternehmensgröße, sondern ob Sie Umweltaussagen in Ihrer Kommunikation verwenden. Für KMU gibt es keine grundsätzlichen Ausnahmen, allerdings können längere Übergangsfristen gelten. Die Anforderungen sind bewusst so gestaltet, dass auch kleinere Unternehmen sie mit verhältnismäßigem Aufwand erfüllen können.
Was passiert mit unseren bestehenden Marketing-Materialien und Produktbeschreibungen?
Alle bestehenden Umweltaussagen müssen bis September 2026 auf ihre Konformität mit den neuen Anforderungen geprüft werden. Das betrifft Websites, Produktverpackungen, Broschüren, Social-Media-Auftritte und Werbematerialien. Pauschale Begriffe wie "umweltfreundlich" oder "klimaneutral" sind nur noch mit nachweisbarer hervorragender Umweltleistung zulässig. Eine systematische Bestandsaufnahme zeigt oft, dass Unternehmen bereits über belastbare Nachhaltigkeitsleistungen verfügen – diese aber bisher nicht ausreichend dokumentiert oder kommuniziert haben.
Wie aufwendig ist die Vorbereitung auf die neuen Anforderungen?
Der Aufwand hängt stark vom aktuellen Reifegrad Ihrer Nachhaltigkeitskommunikation ab. Unternehmen mit bereits strukturierten Prozessen und dokumentierten Umweltdaten können die Anpassungen oft mit überschaubarem Aufwand umsetzen. Die größte Herausforderung liegt meist nicht in der Erfüllung der Anforderungen selbst, sondern in der systematischen Dokumentation bereits vorhandener Leistungen. Ein strukturierter Ansatz mit klarer Priorisierung macht die Vorbereitung planbar und vermeidet, dass kurz vor der Frist unter Zeitdruck reagiert werden muss.
Die Autorin:

Naomi Becker
Naomi Becker ist spezialisiert auf Kommunikation und soziale Aspekte und hat einen interdisziplinären Hintergrund in Literaturwissenschaft, Psychologie und Wirtschaft (M.A.). Als Systemischer Coach und zertifizierte Social Media Managerin (IHK) verbindet sie strategische Nachhaltigkeitskommunikation mit sozialer Verantwortung. Sie unterstützt Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeitsleistungen sichtbar zu machen und glaubwürdig zu kommunizieren.
Kontaktieren Sie uns!
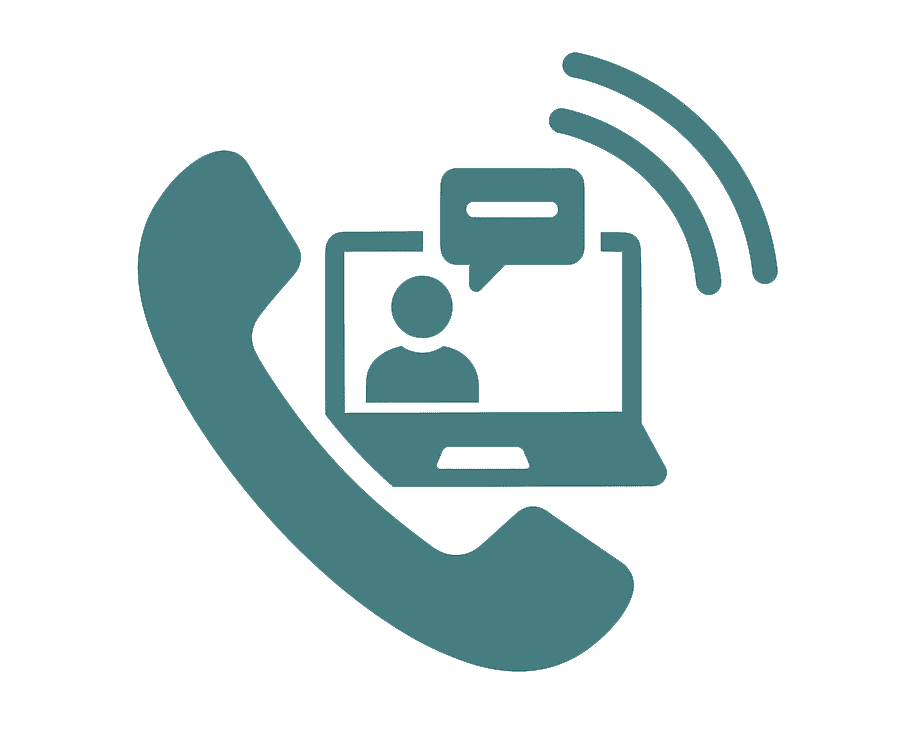
Sie wollen Ihre Nachhaltigkeitsziele in die Umsetzung bringen? Sie wollen mehr über ein ESG-Reporting abgestimmt auf Ihr Unternehmen erfahren? Unterhalten wir uns!
Sie erreichen uns telefonisch unter
+49 (0)7459 931 2429
Oder senden Sie eine Mail an
Buchen Sie unverbindlich Ihren Discovery-Call:

